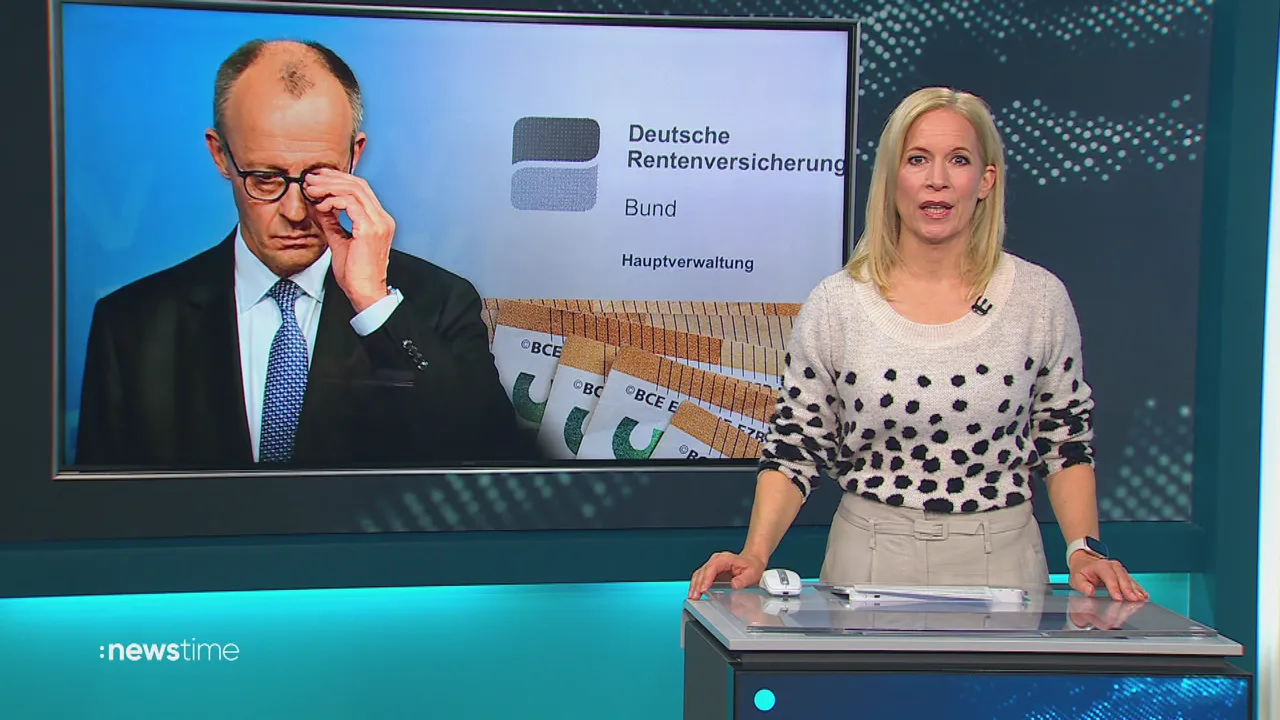Polit-Talk
Ricarda Lang bei Miosga: Jugend fällt bei Schwarz-Rot hinten runter
Veröffentlicht:
von Markus SchlichtingZu Gast im Polit-Talk von Caren Miosga am 16. November 2025: Ricarda Lang (Die Grünen), Ferdinand von Schirach, Martin Machowecz
Bild: NDR/Thomas Ernst
Immer wieder macht die Regierung mit internen Streitigkeiten Schlagzeilen, das Vertrauen in die Politik schwindet. "Haben wir den Kompromiss verlernt?", möchte Caren Miosga wissen. Ihre Gäste sehen strukturelle Probleme – und Vertrauensbrüche durch Kanzler Merz.
Schon als Ricarda Lang nach ihrem Rückzug vom Parteivorsitz der Grünen zum ersten Mal Gast einer Talkshow war, konnte man merken: Da ist eine Last von ihr abgefallen. Das äußerte sich in ihrer Lockerheit – und in Kritik an der eigenen Partei.
Am Sonntagabend (16. November) ist sie zu Gast bei Caren Miosga in der ARD. Und auch da hat sie eine gewisse Leichtigkeit drauf. "Haben wir den Kompromiss verlernt?", will Moderatorin Miosga in dieser Ausgabe ihrer Sendung wissen. Eine berechtigte Frage, denn ein Jahr nach dem Ampelbruch ist das Vertrauen in die schwarz-rote Bundesregierung in der Bevölkerung drastisch gesunken. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen die ständigen Konflikte: über Wehrpflicht, Rente und Haushalt.
Wenn es einen Politiker gibt, dem Ricarda Lang vertraut, dann ist das ihr Parteikollege Omid Nouripour. Das sagt sie gleich zu Beginn des Gesprächs mit Caren Miosga, an dem auch Krimiautor und Jurist Ferdinand von Schirach und der stellvertretende Chefredakteur der "Zeit", Martin Machowetz, teilnehmen.
Schirach fordert "Recht auf Wahrheit"
"Es gibt ja immer diesen Spruch: Es gibt Freunde, es gibt Feinde und es gibt Parteifeinde. Ich finde das eine sehr kindische Vorstellung von Politik", sagt Lang. "Nur wenn man zusammenarbeitet, kann man wirklich gute Ergebnisse hervorbringen. Und meine Erfahrung ist, es gibt auch in der Politik echte Freundschaften und hundertprozentiges Vertrauen, und mit ihm habe ich das."
Ferdinand von Schirach hat vor vier Jahren eine Initiative für eine neue und moderne europäische und deutsche Verfassung gestartet. Darin verlangt er unter anderem ein "Recht auf Wahrheit". Äußerungen von Politiker:innen und Amtsträger:innen müssen demnach der Wahrheit entsprechen. Er habe dabei "ganz extreme Fälle" von Unwahrheit erfassen wollen, sagt der Schriftsteller. "Natürlich lügen Politiker andauernd. Das müssen sie auch tun, das geht gar nicht anders."
Doch im Moment sei das Vertrauen in die Politiker:innen extrem gefährdet, sagt er weiter. Weniger als die Hälfte der Befragten einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung glaubt, die Demokratie in Deutschland würde noch gut funktionieren. "Wenn das Vertrauen so erschüttert ist, ist die Lüge etwas viel Gefährlicheres als in Zeiten, in denen Vertrauen besteht", argumentiert von Schirach.
Das Vertrauen in die Politik werde bei nicht eingehaltenen Versprechen, bei Ungerechtigkeit und bei nicht benannten Problemen erschüttert. Laut von Schirach sind "alle drei Dinge passiert". Bundeskanzler Friedrich Merz verspreche, was er nicht halten könne. Was Gerechtigkeit angehe, sei das Bürgergeld "vollkommen falsch angepackt worden. Man hat gesagt, man spare Geld. Es geht beim Bürgergeld nicht um Geld, sondern um Gerechtigkeit." Die deutsche Infrastruktur schließlich funktioniere "in vielen Bereichen nicht mehr" – ein Problem, das nicht benannt werde.
Lang: Jugend fällt hinten runter
Insbesondere ein gebrochenes Versprechen steht in der aktuellen Diskussion um die Rentenreform im Fokus: „Die Junge Union ist im Moment total verdattert, weil sie gehofft hat, den Kanzler mit ins Boot gehoben zu haben mit einer riesigen Kampagne, von der sie glaubten, dass er gerade in ihrer Frage von Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik auf ihrer Seite steht", sagt "Zeit"-Chefredakteur Machowetz. "Und offenkundig hat er sie da richtig fallen lassen.“ Das Rentensystem sei auf Dauer nicht finanzierbar. Das hätten die Jungen in der Union erkannt.
Ricarda Lang sieht es ähnlich. Die Jugend falle bei sehr vielen Entscheidungen der schwarz-roten Koalition hinten runter, ob Klimaschutz, Bildung oder Rente. Man müsse über das Renteneintrittsalter reden und darüber, wer in die Rentenversicherung einzahle und ob dies auch Beamt:innen tun müssten, fordert Lang. "Im heutigen Rentensystem haben wir aus meiner Sicht drei Ungerechtigkeiten. Die eine ist zwischen Jung und Alt. Die zweite ist zwischen Beamten, Selbständigen, Abgeordneten und denen, die einzahlen."
Außerdem würden Menschen mit besonders harten, aber schlecht bezahlten Jobs "weniger lang vom Rentensystem profitieren", weil sie "tendenziell auch weniger lang leben". Doch bei der Union stecke auch dahinter, dass eine Autorität in Frage gestellt wird. Friedrich Merz und der Fraktionschef Jens Spahn seien nicht in der Lage, ihre eigenen Leute zu überzeugen. "Das liegt daran, dass sie es nicht einmal probieren."
Schwierig sei auch, dass die SPD als Juniorpartner versuche, ihr Programm zu 100 Prozent durchzusetzen, wirft "Zeit"-Chefredakteur Machowetz ein. Tatsächlich könnte die Abstimmung zum Rentenpaket die Koalition sprengen. Machowetz setzt auf das Geschick der Koalitionsführer, zweifelt jedoch, dass gerade Jens Spahn in diesem Fall eine Vermittlerrolle einnehmen kann. "Aber ich sehe die Anzeichen dafür noch nicht, dass das klappen kann." Und das sei am Ende nicht nur die Sache von Spahn.
Eine neue Demokratie für Deutschland?
Von Schirach glaubt ganz allgemein, die Demokratie müsse sich verändern: Der Bundeskanzler müsse für sieben Jahre gewählt werden und dürfe danach nicht mehr antreten. Alle Landtage müssten an einem Tag für dreieinhalb Jahre gewählt werden. Und er bringt "Kanzlergesetze" ins Spiel: "Der Kanzler hat die Möglichkeit, drei Gesetze in diesen sieben Jahren ohne das Parlament zu verabschieden. Das Bundesverfassungsgericht prüft diese Gesetze, bevor sie in Kraft treten, in einem Normenkontrollverfahren. Und das Parlament hat nach drei Jahren die Möglichkeit, diese Gesetze wieder abzuschaffen. Nur so würden sie schwierige Sachen wie die Rentenreform, eine Reform des Arbeitsmarktes, eine Reform der Steuern hinbekommen. In einer Koalition, wie wir sie heute haben, geht das schief."
Ricarda Lang findet die Idee, Landtagswahlen auf einen Tag zu legen, okay. "Aber ich tue mich als Parlamentarier schwer, zu sagen: Nur weil das Parlament nicht mehr so wichtig wird, kriegt man es hin, die großen Reformen zu machen, weil ich das den Parteien schon zutrauen würde." Sie glaubt aber, dass sich Parteien oft zu wichtig nehmen. "Mein Eindruck ist nicht, dass wir den Kompromiss verlernt haben, sondern dass häufig die Parteien in ihren jeweiligen inhaltlichen Positionen fast unklarer, langweiliger und weniger selbstbewusst geworden sind, aber in ihrem Auftreten, im Kulturellen viel verhärteter. Aus meiner Position wäre genau das Gegenteil wichtig: Dass die Parteien gerne wieder in ihren eigenen Positionen klarer und streitlustiger werden."
Ein Problem sei, dass viele Menschen in Deutschland keine Kompromisse wollten, so Machowetz. Sie wollten das erreichen, was für sie das Beste sei. Lang sieht das ähnlich: Weniger Diskussion und mehr Handeln, fordert sie. Und warnt davor, sich zu sehr auf Wahlumfragen zu stützen. "Wir müssen uns wieder als meinungsbildende Kraft sehen", sagt sie.
Ein AfD-Verbot ist eine Pleiteerklärung für die Partei, die es einreicht. Das ist ein Offenbarungseid: Wir haben es nicht geschafft, den Wählern dieser Partei ein Angebot zu machen, dass sie uns wählen können.
Machowitz: Umgang mit AfD "Fehler, den wir als Medien und in der Politik gemacht haben"
Seit der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 9. November wird wieder über ein AfD-Verbotsverfahren diskutiert. "Der Bundespräsident hat eine Haltung", erkennt von Schirach an. "Aber ich teile sie nicht." Ein AfD-Verbot hält er für undemokratisch. Er habe die 1.000-seitige Zusammenfassung des Bundesverfassungsschutzes gelesen, und die gebe ein solches Verbot auch gar nicht her, sagt der Autor und Jurist. Und: "Ein AfD-Verbot ist eine Pleiteerklärung für die Partei, die es einreicht. Das ist ein Offenbarungseid: Wir haben es nicht geschafft, den Wählern dieser Partei ein Angebot zu machen, dass sie uns wählen können."
Die AfD sei keine Protestpartei mehr, sagt Machowetz. Viele Menschen wollten inzwischen von ihr regiert werden und ermöglichen, dass sie ihre Ideen umsetzen kann. "Es tut einem in der Seele weh, dass es so weit gekommen ist", fügt der Journalist hinzu. "Es war in den letzten Jahren so, dass viele Menschen gesagt haben, sie hätten eine vollkommen andere Meinung, und warum ist die so wenig zu sehen und zu hören. Das ist auch ein Fehler, den wir als Medien und in der Politik gemacht haben: Wir hätten es nicht soweit kommen lassen dürfen, dass die Menschen in der AfD einen Faktor sehen, der dafür da ist, Wahrheiten auszusprechen, die vielleicht am Ende gar keine Wahrheiten sind."
:newstime verpasst? Hier aktuelle Folge ansehen
Mehr entdecken

Treffen mit Merz und Macron
Vor Digitalgipfel: Tech-Branche fordert einheitliche EU-Regeln und mehr Kapital

"Wir sind eine Nation des Rechts"
Netanjahu will gegen Siedlergewalt im Wesjordanland vorgehen

Schwerer Unfall
Reisebus in Vietnam von Erdrutsch mitgerissen – sechs Tote

Polizeipräsenz verstärkt
Eltern in Angst: Anschlagsdrohungen gegen Berliner Schulen kursieren im Netz

Sexualstraftäter-Fall
Kurswechsel: Trump empfiehlt Abstimmung über Epstein-Aktenöffnung

Jugendgewalt
Verletzt und ausgeraubt: Fünf Jugendliche attackieren Kinder auf Berliner Spielpatz